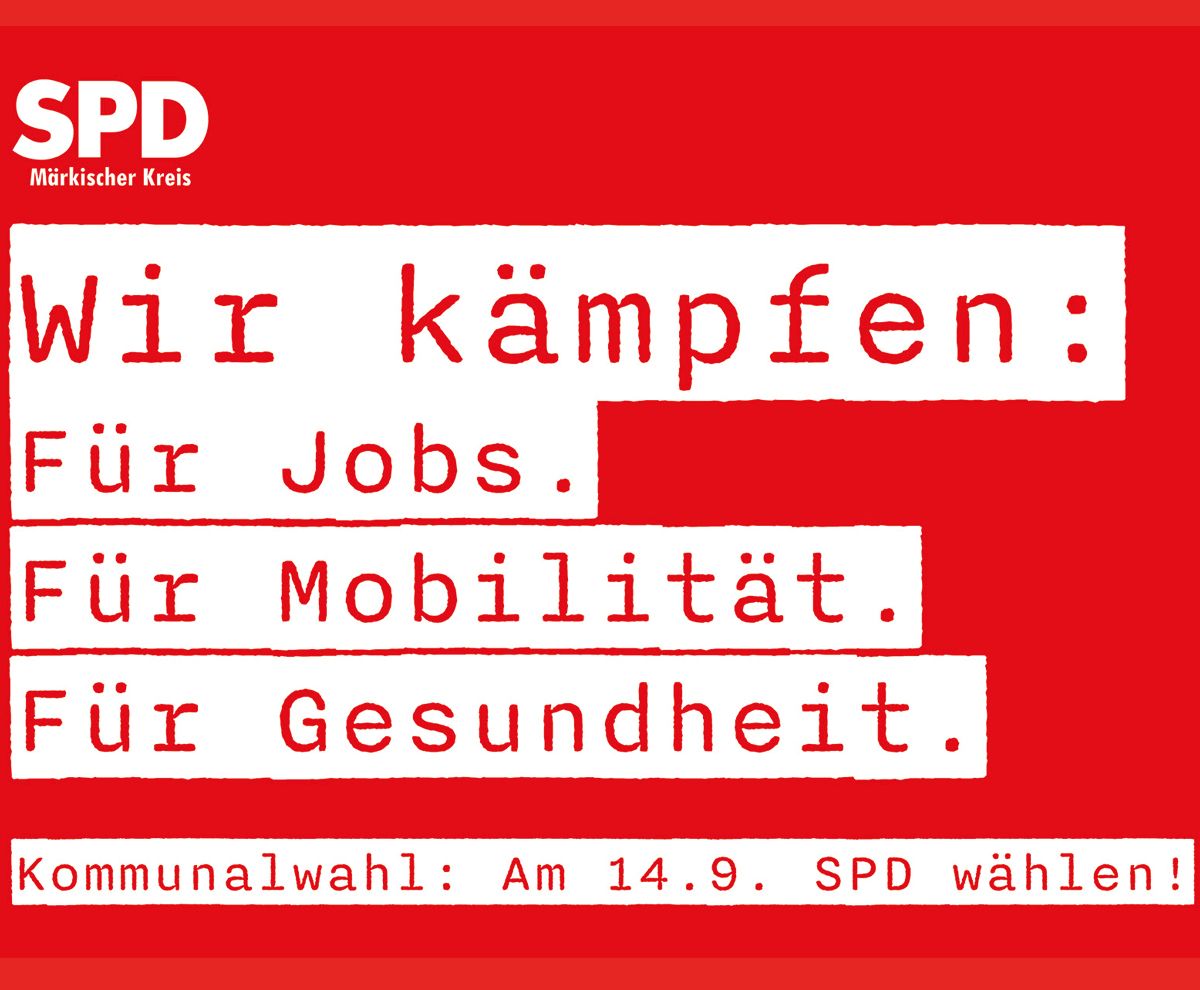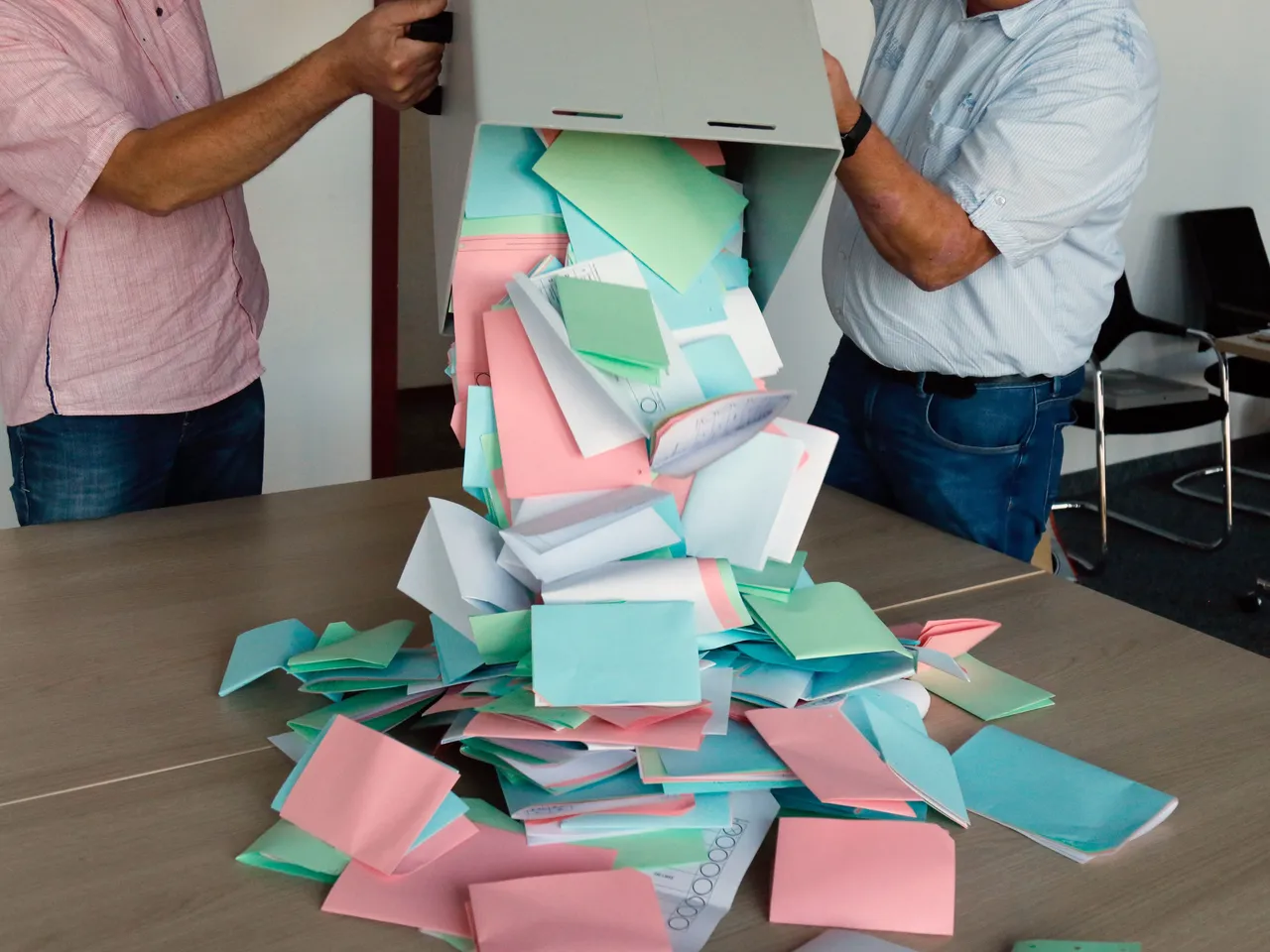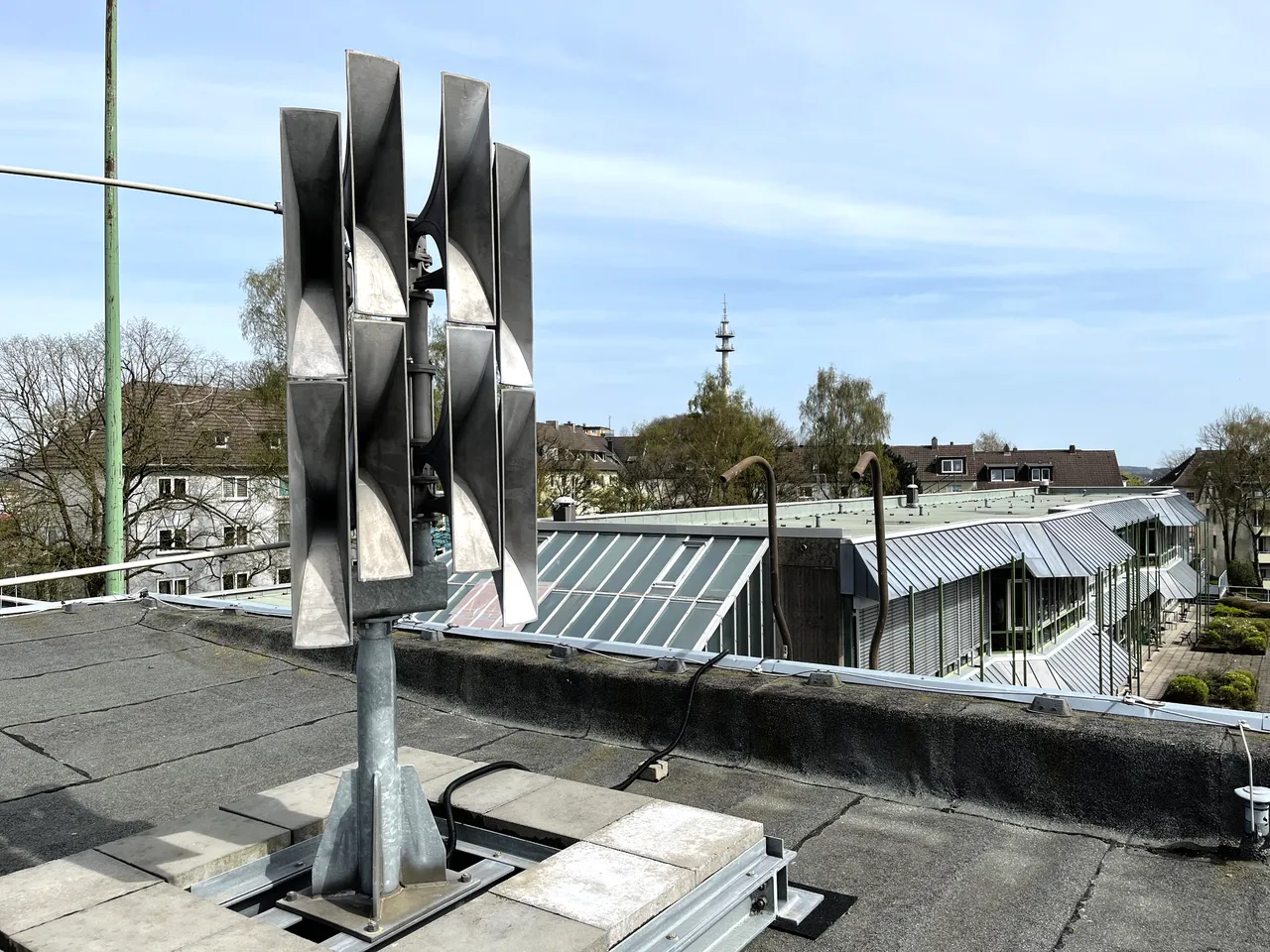Interview.
Zwei Kandidaten - ein Amt. Am 14. September dürfen die Bürger von Kierspe entscheiden wer ihr neuer Bürgermeister wird. LokalDirekt stellt die beiden Kandidaten in ausführlichen Interviews vor. Warum wollen sie Bürgermeister werden? Was für Kernpunkte vertreten sie? Was ist ihre Vision für Kierspe? Diese Fragen beantwortet im Folgenden Nico Howorka, Bürgermeisterkandidat der FWG.
LokalDirekt: Herr Howorka, stellen Sie sich bitte einmal vor.
Howorka: Mein Name ist Nico Howorka. Ich bin 52 Jahre alt, verheiratet und habe einen 16-jährigen Sohn, der gerade auf Sprachreise in Malta ist. In Kierspe lebe ich bereits seit 1988. Meine Frau habe ich im Jahr 2000 kennengelernt und seit dreieinhalb Jahren sind wir verheiratet. Ich fühle mich hier sehr wohl – sonst hätte ich es wohl kaum so lange hier ausgehalten. Kierspe bietet mir viele Möglichkeiten, mein Privatleben wie auch mein berufliches Leben zu gestalten. Deshalb lebe ich gerne hier.
Wir haben uns hier am Fritz-Linde-Stein getroffen. Sie sollten einen Treffpunkt wählen, der für Sie eine besondere Bedeutung hat. Warum ist es dieser Ort geworden?
Der Fritz-Linde-Stein ist für mich ein markanter Punkt, ähnlich wie die Thingslinde am Ortseingang von Kierspe. Hier verlief einst ein alter Handelsweg von Dortmund nach Frankfurt. Außerdem hat man von hier eine herrliche Aussicht ins Volmetal und ins Kerspetal. Man kann hier sehr gut sehen, in was für eine schöne Natur Kierspe eingebettet ist.
Sie haben in der letzten Ratssitzung beantragt, das Umfeld des Fritz-Linde-Steins aufzuwerten. Dieser Vorschlag stieß sowohl bei Ihren Ratskollegen als auch bei den Bürgern auf Skepsis. Was würden Sie diesen entgegnen. Warum möchten Sie das Gebiet aufwerten?
Wir möchten diesen Ort gerne aufwerten, weil er ein wichtiger Anlaufpunkt für Kierspe ist – sowohl für Wanderer als auch für Radfahrer. In der Vergangenheit gab es hier bereits Sitzmöglichkeiten, doch das führte leider auch zu Vandalismus und zu viel Lärm durch an- und abfahrende Fahrzeuge. Unser Ziel ist es, diesen schönen Naturfleck so zu gestalten, dass Menschen hier verweilen können: um die Aussicht ins Volmetal und ins Kerspetal zu genießen, Ruhe zu finden, im Schatten zu sitzen – dieser fehlt vielerorts – und einfach zu entspannen. Gleichzeitig soll dieser Platz auch ein Treffpunkt für Bürgerinnen und Bürger aus Kierspe werden, an dem man sich begegnet und zusammenkommt.
Was motiviert Sie dazu, für das Bürgermeisteramt zu kandidieren?
Das ist eine schwierige Frage. Ich bin seit rund sieben Jahren politisch aktiv und wurde in der letzten Wahlperiode erstmals in den Rat gewählt. Von Beginn an hat es mich fasziniert, Entscheidungen treffen zu dürfen, Bürger mitzunehmen und Dinge umzusetzen, die wir hier als Kommune noch selbst gestalten können. Genau das ist meine größte Motivation. Natürlich müssen wir viel auf bundes- und landespolitische Vorgaben reagieren, doch es bleibt ein kleiner Teil, in dem wir auf kommunaler Ebene wirklich etwas verändern können. Es ist nicht viel, aber wir wollen unsere schöne Stadt erhalten, sie zukunftsfähig gestalten und dafür sorgen, dass wir stolz auf Kierspe sein können – nicht nur bis 2030, sondern auch darüber hinaus, bis 2040 und 2050.
Kommen wir zu Ihrem Wahlprogramm. Sie sagen, das Bürgermeisteramt sei kein Verwaltungs-, sondern ein Gestaltungsamt. Warum ist es aus Ihrer Sicht ein Vorteil, wenn ein Bürgermeister nicht aus der Verwaltung kommt?
Verwaltungsbeamte verwalten gerne den Ist-Zustand. Sie konzentrieren sich darauf, Bestehendes zu erhalten, sind aber weniger daran interessiert, aktiv zu gestalten. Was aus meiner Sicht häufig fehlt, ist die Möglichkeit, Erfahrungen aus der Privatwirtschaft und aus der Bürgerschaft einzubringen. Für mich ist das Bürgermeisteramt deshalb vor allem eine Chance, nicht nur meine eigenen Vorstellungen, sondern auch die der Kiersper Bürger in die Verwaltung hineinzutragen. Mit den Bürgerfragestunden haben wir bereits einen Anfang gemacht, den ich gerne weiter ausbauen möchte. Dabei soll die Verwaltung selbstverständlich ihre eigenständigen Aufgaben erfüllen, während der Bürgermeister dafür sorgt, dass sie zusammenhält und die Stadt nach außen hin gut repräsentiert. Ich bin überzeugt, dass jemand, der nicht aus der Verwaltung kommt, diese Rolle besser ausfüllen kann – weil er weniger auf die eigene Zukunft oder Pension schaut, sondern stärker auf die Anliegen der Bürger und nicht ausschließlich auf die Belange der Verwaltung.
Das heißt, Sie wollen bürgernäher sein und die Anliegen der Bürgerschaft in den Mittelpunkt stellen?
Ja, genau. Das ist mein Ziel und auch das Ziel meiner Fraktion.
In Ihrem Programm zeichnen Sie ein ziemlich hartes Bild der Lage im Rathaus. Sie sprechen von Mangelverwaltung, unbesetzten Stellen, Abwanderung guter Mitarbeiter und schlechter Stimmung. Das sind schwere Vorwürfe an Olaf Stelse und seine Führungskräfte. Worauf stützen Sie diese Kritik?
Ich möchte das nicht allein auf die Amtszeit von Herrn Stelse zurückführen. Das Problem besteht schon seit längerer Zeit. Immer wieder werden Mitarbeiter aus dem Kiersper Rathaus von anderen Städten abgeworben – zum Beispiel aus dem Ordnungsamt nach Meinerzhagen, wo es bessere Bezahlung und weniger Arbeitsstunden gibt. In Kierspe werden solche Stellen nicht adäquat nachbesetzt, da die Verwaltung dem guten Glauben unterliegt, wir müssten uns einem ständigen Sparkurs unterziehen, den wir weiterführen müssen. Das bedeutet, dass neue Mitarbeiter oft gar nicht eingestellt werden, sondern Stellen lediglich intern verschoben oder Bereiche zusammengelegt werden. Natürlich zahlt die Verwaltung nach ihren Möglichkeiten, aber so lässt sich keine zukunftsfähige Struktur aufbauen. Ständig muss man im Hinterkopf haben, dass gute Leute abwandern können, weil sie anderswo bessere Bedingungen, mehr Freizeit und mehr Gestaltungsmöglichkeiten vorfinden. Für Kierspe ist das ein erheblicher Einschnitt.
Sie wollen also einen Kurswechsel im Rathaus erreichen, um die Verwaltung effizienter und attraktiver zu machen?
Effizienz ist nicht das Problem. Ich möchte nicht behaupten, dass wir in Kierspe ineffizient arbeiten. Mir geht es vielmehr darum, die Verwaltung attraktiver zu machen. Oft hat man den Eindruck, dass die Mitarbeiter ihren Dienst nach Vorschrift tun, sich aber darüber hinaus wenig Gedanken machen, wie man Kierspe voranbringen könnte. Dabei ginge es darum, in den einzelnen Ressorts Ideen zu entwickeln, wie wir die Stadt verbessern, verschönern und insgesamt attraktiver für die Zukunft machen können. Dieses Gefühl hat sich bei mir in den vergangenen Jahren verstärkt – und es betrifft nicht nur die aktuelle Legislaturperiode, sondern war auch schon zuvor spürbar.
Dieses Problem ist also aus Ihrer Sicht schon altbacken?
Ja, genau. Wir hatten nun 21 Jahre lang einen Bürgermeister, der aus der Verwaltung kam – ein klassischer Verwaltungsbeamter. Er brachte aber weder Erfahrungen aus der Privatwirtschaft noch aus der Bürgerschaft mit.
Bleiben wir beim Thema altbacken. Die Freie Wählergemeinschaft tritt seit 2009 mit sehr ähnlichen Forderungen an. Sie selbst schreiben, die Grundlagen von damals würden immer noch gelten. Warum haben Sie diese Ideen in den letzten 16 Jahren nicht umgesetzt? Könnte es daran liegen, dass einige Vorschläge nicht mehr zeitgemäß und auch ein bisschen altbacken sind?
Bei der Umsetzung älterer Punkte aus unserem Wahlprogramm sind wir in der Vergangenheit oft daran gescheitert, dass uns die Mehrheiten fehlten. Viele Entscheidungen wurden im Vorfeld bereits abgesprochen, sodass wenig Raum für Veränderungen blieb. Es mag sein, dass wir an mancher Stelle alte Ideen beibehalten wollen. Aber das liegt in der Natur des Menschen: Nicht alles, was sich bewährt hat, muss man über Bord werfen. Dennoch ist uns bewusst, dass wir für die Zukunft gerüstet sein müssen. Veränderungen sind notwendig, wir müssen sie akzeptieren und selbst gestalten – sonst geraten wir irgendwann an einen Punkt, an dem wir nicht mehr weiterkommen und handlungsunfähig werden. Natürlich müssen wir uns auch die Kritik gefallen lassen, dass wir an Dingen festhalten, die vielleicht nicht mehr überall zeitgemäß sind, Dinge, die eventuell auch in der Zukunft nicht wirklich umsetzbar sind.
Warum kandidieren Sie dann mit solchen Punkte, die man in der Zukunft nicht mehr umsetzen kann, in Ihrem Wahlprogramm?
Wir haben das Thema bewusst in unserem Wahlprogramm behalten, weil wir überzeugt sind, dass ein Stadtentwicklungskonzept notwendig ist. In der letzten Ratssitzung wurde unser Antrag dazu zwar abgelehnt, aber für uns ist es wichtig, zunächst den Ist-Zustand von Kierspe darzustellen. Darauf aufbauend wollen wir Wege aufzeigen, wie sich die Stadt entwickeln kann. Anschließend müsste man in die konkrete Planung einsteigen und prüfen, welche Maßnahmen umsetzbar sind. Einzelne Konzepte gibt es bereits – etwa das Dorfentwicklungskonzept für Rönsahl, für Kierspe-Dorf oder aktuell in kleinem Maßstab für den Bereich im Bahnhof. Aber uns fehlt ein übergeordnetes Konzept für die gesamte Stadt. Kierspe ist eine Einheit, und so sollten wir auch agieren: mit einem umfassenden Stadtentwicklungskonzept, das nicht nur einzelne Bereiche betrachtet, sondern die Zukunft der gesamten Stadt in den Blick nimmt.

Ein zentrales Thema in Ihrem Programm ist besagtes Stadtentwicklungskonzept, das Sie die „einzige Lösung für Kierspes Zukunft“ nennen. Was genau stellen Sie sich darunter vor und was erhoffen Sie sich davon?
Wir wollen eine langfristige Perspektive entwickeln – über 2030, 2040 und 2050 hinaus. Einzelne Konzepte für Rönsahl, Kierspe-Dorf oder den Bahnhofsbereich gibt es bereits. Aber uns fehlt ein Gesamtplan für die gesamte Stadt. Wir sollten als eine Kommune auftreten und ein Konzept entwickeln, das die Zukunft von ganz Kierspe abbildet.
Es gibt Personen die befürchten, dass ein Stadtentwicklungskonzept kurzfristig zu einem Baustopp führt. Was entgegnen Sie?
Wir erhoffen uns davon, dass wir Kierspe auch über 2030, 2040 und 2050 hinaus als eine lebens- und liebenswerte Stadt erhalten können. Mit dem Stadtentwicklungskonzept wollen wir deutlich machen, dass wir eine Zukunft für Kierspe sehen, die allerdings nicht durch einzelne Maßnahmen allein zu erreichen ist, sondern nur im Gesamten. Und genau so sollten wir es auch betrachten: nicht in isolierten Projekten, sondern in der Gesamtheit – als eine Kommune, die ihre Entwicklung gemeinsam plant und umsetzt.
Könnte sich dieses Stadtentwicklungskonzept auch (kurzfristig) negativ auf Kierspe auswirken? Sie fordern bis zur endgültigen Entwicklung dieses Konzepts keine weiteren Baugebiete oder Industrieflächen auszuweisen. Durch einen solchen Baustopp könnte sich Kierspe, bis zum Beschluss dieses Konzepts, nicht weiterentwickeln.
Das sehe ich anders. Wir befürworten, dass neue Flächen für Wohngebiete derzeit nicht weiterverfolgt werden – etwa östlich des Rathauses. Stattdessen sollte der Fokus zunächst auf den innerstädtischen Bereich gelegt werden: auf Baulücken, Leerstände und Gebäude, die absehbar nicht mehr genutzt werden und einer anderen Verwendung zugeführt werden können. Das ist das, was wir kurzfristig tun können. Das Stadtentwicklungskonzept hingegen ist viel weitergedacht. Es soll nicht nur für die nächsten fünf bis zehn Jahre gelten, sondern langfristig angelegt sein, auf Jahrzehnte hinaus, um die Entwicklung von Kierspe dauerhaft zu sichern.
Das heißt, die Zeit, bis das Stadtentwicklungskonzept greift, würden Sie mit solchen Nachverdichtungsmaßnahmen überbrücken wollen?
Genau.
In Ihrem Wahlprogramm schreiben Sie, Kierspe habe ein strukturelles Defizit in seinem Haushalt. Steuererhöhungen oder rigides Sparen lehnen Sie ab. Wie soll die Stadt künftig finanziell aufgestellt werden? Wie sieht Ihre Lösung für ein finanzstarke Stadt Kierspe aus?
Eine komplette Lösung würde jetzt sicherlich den zeitlichen Rahmen sprengen. Für uns ist aber vor allem eines wichtig: die Einhaltung des Konnexitätsprinzips. Ganz einfach gesagt bedeutet das: Wer Aufgaben bestellt, muss auch für die Kosten aufkommen. Und genau das geschieht derzeit nicht. Die Kommunen übernehmen etwa 25 Prozent der Aufgaben, die eigentlich Bund und Land betreffen, erhalten dafür aber nur rund 14 Prozent an finanzieller Unterstützung zurück. Die fehlenden 11 Prozent müssen wir hier in Kierspe selbst tragen – und das bringt uns an unsere Grenzen. Beim Sparen denken viele sofort an den Verzicht auf freiwillige Leistungen. Doch genau das ist nicht unser Weg. Uns liegt viel daran, Kierspe attraktiv zu machen: für Unternehmen, die hier investieren und Gewerbesteuern zahlen, und für Menschen, die hier einkaufen und Geld in der Stadt lassen. Das wollen wir gezielt fördern, um zusätzliche Einnahmen zu schaffen und damit die städtischen Finanzen zu verbessern. Natürlich ist uns klar, dass das kein Allheilmittel ist. Wir sind nicht blauäugig und behaupten nicht, unsere Lösung sei die einzig richtige. Wahrscheinlich wird es auf eine Kombination verschiedener Maßnahmen hinauslaufen: Gelder einsparen, die nicht zwingend ausgegeben werden müssen, und gleichzeitig investieren, um Anreize für Zuzug und für die Ansiedlung von Industrie zu schaffen.
Das bedeutet, Sie wollen weniger sparen, sondern vor allem mehr Einnahmen erzielen?
Genau, langfristig ist das unser Ziel. Wir wollen mehr Einnahmen über die Gewerbesteuer erzielen – und zwar durch Unternehmen, die sich hier ansiedeln, aber auch durch Menschen, die in Kierspe einkaufen, ihre Freizeit verbringen und sich vielleicht sogar dauerhaft niederlassen. Wir sehen hier großes Potenzial: Wenn wir Kierspe attraktiver machen, können wir zusätzliche Einnahmen generieren – durch Gewerbesteuern, durch Besucher aus dem Bereich Tourismus oder Privatwirtschaft, die hier Geld ausgeben, und durch neue Bürgerinnen und Bürger, die sich für Kierspe als Wohnort entscheiden.
Wie passt das mit den steigenden Kosten des Märkischen Kreises und der Kreisumlage zusammen? Haben Sie hierfür Ansätze, auch wenn dies nicht direkt in Ihre Zuständigkeit als Bürgermeister fällt?
Genau darin liegt unser Problem: Durch die Kreisumlage haben wir überhaupt keinen Handlungsspielraum. Wir müssen sie entrichten, ohne bei ihrer Gestaltung mitreden zu dürfen. Die Umlage wird vom Märkischen Kreis festgelegt – die Bürgermeister haben darauf so gut wie keinen, wenn überhaupt irgendeinen Einfluss. Und daran wird sich kurzfristig auch nichts ändern lassen.
Von der Kreisumlage werden jedoch auch Dinge finanziert, die auch der Stadt Kierspe zugutekommen. Sei es zum Beispiel die MVG oder das Klinikum Hellersen.
Beim Klinikum Hellersen haben wir das Problem, dass das Ende der Fahnenstange noch längst nicht erreicht ist. Wir wissen schlicht nicht, was in den nächsten Jahren auf die Kommunen zukommt, weil es bislang keinen detaillierten Finanzierungs- oder Maßnahmenplan gibt. Inzwischen ist sogar von einem kompletten Neubau des Krankenhauses die Rede. Wie sich das konkret auf Kierspe auswirkt, können wir nicht absehen. Genau das betont auch unsere Kämmerin immer wieder: Niemand weiß, welche Belastungen auf die Städte zukommen, wenn tatsächlich ein Notfall eintritt. Im Raum stehen Kosten von rund 150 Millionen Euro für das Klinikum, die möglicherweise auf die Kommunen umgelegt werden. Was das am Ende für Kierspe bedeutet, ist völlig offen.
Bleiben wir im medizinischen Bereich. Sie schlagen vor, ein medizinisches Versorgungszentrum in Kierspe, mit zwei städtisch angestellten Hausärzten aufzubauen.
Das sollte der Anfang sein.
Aber auch schon dieser Anfang kostet schon viel Geld. Wie soll das funktionieren, ohne die Stadtkasse zu überlasten, ohne am Ende vielleicht doch die Steuern steigen zu lassen oder an anderen Stellen zu sparen?
Wir diskutieren in der Fraktion immer wieder darüber, wie ein medizinisches Versorgungszentrum in Kierspe gestaltet werden könnte. Aus heutiger Sicht wird es für die Kommune allerdings kaum möglich sein, ein solches Zentrum selbst zu errichten – die finanziellen Mittel reichen schlicht nicht aus. Deshalb müssen wir Rahmenbedingungen schaffen, die es attraktiv machen, dass sich Privatinvestoren beteiligen. Vielleicht finden wir auch Ärzte, die bereit sind, sich einzubringen und ein solches Zentrum zu leiten. Dafür braucht es jedoch ein geeignetes Gebäude und genügend Ärztinnen und Ärzte, die dort arbeiten möchten. Aus meiner Sicht wird ein Versorgungszentrum in Kierspe daher nicht als kommunales, sondern nur als privatwirtschaftlich getragenes Modell realisierbar sein.
Auch in der Wirtschaftsförderung setzen Sie auf neue Impulse, etwa mit einem Serviceportal für Unternehmen, welches diese bei Behördengängen und Anträgen unterstützt. Was versprechen Sie sich von diesem Portal? Glauben Sie tatsächlich, dass dieses neue Firmen anziehen und Arbeitsplätze schaffen kann?
In erster Linie ist dieses Serviceportal für Unternehmen gedacht, die bereits in Kierspe ansässig sind. Es soll verhindern, dass jeder Unternehmer mit seinen Anliegen verschiedene Stellen einzeln anlaufen muss. Stattdessen gibt es einen zentralen Ansprechpartner, an den man sich wenden kann, um Fragen, Probleme oder Wünsche vorzubringen. Von dort aus werden die Anliegen im Rathaus beziehungsweise in der Verwaltung an die richtigen Fachbereiche weitergeleitet. So spricht man mit einer einzigen Stelle und nicht mit vielen verschiedenen. Das spart Zeit – und diese Zeit können Unternehmen besser nutzen, als sich durch die gesamte Verwaltung arbeiten zu müssen. Im Grunde ist das Portal also eine Bündelungsstelle: ein zentraler Kontaktpunkt für die Firmen.
Bleiben wir bei der lokalen Wirtschaft. Sie wollen Kiersper Handwerksbetriebe bei städtischen Aufträgen bevorzugen – nach dem Motto „Kierspe first“. Wie soll das konkret aussehen und wie wollen Sie dabei rechtliche Grenzen einhalten?
In diesem Fall geht es speziell um die Handwerksbetriebe, denn sie sind diejenigen, die für die Stadt Leistungen erbringen – etwa bei Schulreparaturen, Instandhaltung oder Straßenbau. Wir möchten Kiersper Unternehmen ausdrücklich ermutigen, Angebote abzugeben. Oft tun sie das gar nicht, weil von vornherein klar ist, dass sie preislich nicht mithalten können. Dabei sollte man von der reinen Preisorientierung wegkommen. Die Erfahrung zeigt: Was auf den ersten Blick günstig wirkt, wird im Endeffekt oft teurer, weil bestimmte Dinge nicht berücksichtigt wurden. Wenn wir dagegen Handwerker aus Kierspe beauftragen, hat das mehrere Vorteile: Wir sichern Arbeitsplätze vor Ort, die Gewerbesteuer bleibt in der Stadt, und wir haben bei Problemen einen viel schnelleren und direkteren Zugriff auf die Unternehmen. Genau deshalb wollen wir Kiersper Betriebe bevorzugen. Natürlich müssen wir die rechtlichen Rahmenbedingungen beachten – das bleibt zu prüfen. Aber unser Ziel ist, die heimischen Unternehmen möglichst vorrangig einzubinden, ihnen die Chance zu geben, sich an der Gestaltung, an Renovierungen, an Instandhaltung und Sanierungen in Kierspe zu beteiligen und ihre Angebote so zu gestalten, dass wir auf sie zurückgreifen können.
Kierspe kämpft mit Leerständen, einem Bevölkerungsrückgang und man hört immer wieder von Firmen, denen die Attraktivität fehlt. Was wollen Sie tun, um die Stadt für junge Familien attraktiver zu machen?
In Kierspe haben wir bereits ein breites Angebot an Sport- und Freizeitmöglichkeiten – allen voran die Anlage Felderhof, die in der Region ihresgleichen sucht und zudem frei zugänglich ist. Wichtig ist, dass wir auch den jungen Leuten attraktive Angebote machen. Viele von ihnen gehen gerne auf Veranstaltungen, andere nutzen das Fahrrad ganz anders als ältere Generationen: Sie möchten durch den Wald fahren, Sprünge machen und sportliche Herausforderungen meistern. Darauf müssen wir eingehen und entsprechende Angebote schaffen. Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Errichtung des neuen Beachvolleyballplatzes, der bereits in Planung ist und demnächst realisiert werden soll. Vielleicht gelingt es uns, rund um die Sportanlagen Felderhof noch weitere Attraktionen zu entwickeln, sodass dort ein Freizeitbereich entsteht, der Familien anspricht. So könnten wir auch die bestehenden Baulücken in Kierspe attraktiver machen, damit sich Menschen hier niederlassen, statt in unberührter Natur neue Häuser zu bauen. Über die Gestaltung unserer Freizeitmöglichkeiten wollen wir also einen echten Mehrwert schaffen – einen Attraktivitätsbonus, der dazu beiträgt, dass sich Familien in Kierspe wohlfühlen und langfristig hierbleiben.
Stichwort Felderhof. Ihr Antrag die Vermarktung zu intensivieren, wurde im Rat abgelehnt. Dennoch steht dies auch immer noch in Ihrem Wahlprogramm. Würden Sie das im Zweifelsfall als Bürgermeister auch gegen den politischen Willen durchsetzen?
Ich würde nicht so weit gehen, etwas gegen den politischen Willen durchzusetzen. Allerdings wurde das Thema in der damaligen Ratssitzung nicht so dargestellt, wie wir es uns eigentlich vorgestellt hatten. Der Fokus lag ausschließlich auf den Kosten und der Frage, ob Bürgerinnen und Bürger für Freizeitmöglichkeiten bezahlen sollen. Das war aber nie unsere Intention. Freizeitangebote sollen allen weiterhin kostenfrei zur Verfügung stehen. Unser Anliegen war vielmehr, die Sporthalle auch für andere Veranstaltungen zu nutzen. Früher hatten wir den VfL Gummersbach hier oder Handballmannschaften aus Schalksmühle, die in Kierspe gespielt haben. Solche Veranstaltungen würden zusätzliche Einnahmen bringen, mit denen die Stadt einen Teil der hohen Instandhaltungskosten decken könnte – Kosten, die jährlich im sechsstelligen Bereich liegen. Natürlich könnten wir diese nicht zu hundert Prozent finanzieren, aber zumindest einen spürbaren Beitrag leisten, um die Sportstätten attraktiver zu machen. Der CVJM organisiert beispielsweise jedes Jahr ein großes Volleyballturnier zu Pfingsten. Warum sollte man nicht auch die umliegenden Flächen – wie die Wiesen beim Fußballgolf oder rund um die Sportstätten – für ähnliche Veranstaltungen nutzen? Gegen einen Obolus ließen sich solche Events durchführen, und die Stadt könnte zusätzliche Einnahmen erzielen. Das bedeutet jedoch ausdrücklich nicht, dass jede private Nutzung der Sportstätten künftig kostenpflichtig werden soll. Das war nie unser Ziel.
Ein anderes Dauerthema in Kierspe ist der Verkehr, besonders seit der Sperrung der A45-Brücke und der Sperrung der Brücke am Tannenbaum. Welche Lehren ziehen Sie daraus? Wie lässt sich so etwas in Zukunft vermeiden?
Wir haben schon vor einiger Zeit angeregt, die Gradienten in Oberbrügge abzusenken, um LKW aus Kierspe herauszuhalten. Doch dieses Vorhaben wurde – auf Betreiben des Bürgermeisters von Halver – vehement abgelehnt. Er hat klar gesagt: „Mit mir wird es das nicht geben.“ Dabei frage ich mich, warum es an anderer Stelle funktioniert hat. In Hagen gab es eine ähnliche Problematik. Dort war die bauliche Situation zwar etwas anders, aber die Absenkung wurde umgesetzt – auch, weil sich Verantwortliche aus Schalksmühle hartnäckig eingesetzt haben. Sie haben regelmäßig beim Kreis nachgehakt und Druck gemacht. Von Kiersper Seite hingegen gab es nur ein, zwei Telefonate – und dann war das Thema erledigt. Es fehlte schlicht an Vehemenz. Mit einer Absenkung der Gradienten hätten wir den überregionalen LKW-Verkehr – etwa Richtung Wuppertal oder andere Gebiete – komplett aus Kierspe heraushalten können. Nur der Anliefer- und Nahverkehr hätte dann weiterhin durch die Stadt gemusst. Und wir müssen uns bewusst sein: In zehn Jahren haben wir mit der Brücke am Tannenbaum voraussichtlich das gleiche Problem erneut. Spätestens dann stellt sich die Frage, wie wir frühzeitig mit besserer Verkehrsplanung gegensteuern können. Die aktuelle Regelung, dass LKW nicht durch die Schnörrenbach fahren dürfen, halte ich nur bedingt für sinnvoll. Im Winter, bei Schnee und Eis, ist das nachvollziehbar – da sind Auf- und Abstiege für LKW kaum zu bewältigen. Aber jetzt, bei Frühlings- und Sommertemperaturen, sehe ich täglich, dass 20 bis 30 LKW problemlos dort entlangfahren. Ich bin dort mit meiner Firma ansässig, ich sehe es jeden Tag. Warum also Straßen, die wir haben, nicht nutzen? Neben der Strecke über Schnörrenbach bleiben ohnehin nur Rönsahl und Halver als Alternativen. Dass die Gradientenabsenkung in Oberbrügge nicht umgesetzt wurde, war ein schwerer Fehler. Dadurch muss der gesamte Lieferverkehr weiter mitten durch Kierspe rollen. Diese Chance, das Problem rechtzeitig zu entschärfen – wie es etwa in Hagen gelungen ist – wurde bei uns leider verpasst.
Gerade an der Schnörrenbach, wo auch Ihre Firma am Ende der Strecke ansässig ist, gab es ja kurz nach Inkrafttreten der Umleitung am Tannenbaum bereits den ersten Unfall. Damit fiel sofort eine der drei wenigen Ausweichmöglichkeiten weg, die überhaupt zur Verfügung stehen. Worauf ist dieser Unfall zurückzuführen?
Das kann ich nicht beurteilen, das entzieht sich meiner Kenntnis. Offensichtlich muss es ein Problem oder ein Fehler gegeben haben, der dazu führte, dass der LKW von der Straße abkam. Was genau, weiß ich nicht. Aber ein solcher Einzelfall darf nicht dazu führen, den LKW-Verkehr grundsätzlich durch die Schnörrenbach zu verbieten. Wir haben tagtäglich viele Unfälle auf verschiedensten Straßen – trotzdem werden diese nicht sofort für Motorradfahrer, Autofahrer oder andere gesperrt. Gerade deshalb sollte man hier mit mehr Augenmaß vorgehen und Rücksicht auf die LKW-Fahrer nehmen, die ohnehin schon Schwierigkeiten haben, passende Routen zu finden. Bei den aktuellen Temperaturen und zu dieser Jahreszeit sehe ich keinen Grund für eine Sperrung: Es ist nicht glatt, die Strecke ist übersichtlich. Zudem dürfen landwirtschaftliche Fahrzeuge dort fahren – und die bringen teils sogar mehr als 40 Tonnen auf die Waage. Für sie gibt es keine Einschränkungen. Deshalb bin ich der Meinung, dass man auch LKW die Durchfahrt über die Schnörrenbach für eine gewisse Zeit ermöglichen sollte – nicht dauerhaft, aber zumindest zeitlich begrenzt.
Sie sprachen gerade über die Landwirte in Kierspe, welche hier sehr aktiv vertreten sind. Doch je weiter die landwirtschaftlichen Flächen hier ausgebaut werden, desto weniger behalten wir von der eigentlichen Natur. Wie wollen Sie den Charakter der Natur erhalten? Welche Prioritäten setzen Sie im Bereich Umwelt? Geht es vor allem um den Erhalt von Wald und Landschaft, um sauberes Wasser oder geht es für Sie um die Landwirtschaft?
Uns geht es in erster Linie um die Erhaltung unserer Natur und der reinen Luft, die wir hier vor Ort haben. Kierspe ist ein von Talsperren geprägtes Gebiet, sowohl Trinkwasser- als auch Nutzwassertalsperren. Diese Landschaft gilt es zu bewahren. Natürlich werden wir uns in Zukunft dem globalen Bevölkerungswachstum stellen müssen, auch wenn das in Kierspe selbst eher durch den demografischen Wandel abgeschwächt wird. Umso wichtiger ist es, die vorhandenen landwirtschaftlichen Flächen nicht weiter zu reduzieren. Sie dürfen nicht durch großflächige Solar- oder Windparks verdichtet werden, die dann nicht mehr für die Landwirtschaft zur Verfügung stehen. Das ist für uns ein zentrales Ziel. Dabei sind wir keineswegs gegen erneuerbare Energien oder Umweltschutz, wie uns oft unterstellt wird. Wir plädieren lediglich dafür, zunächst versiegelte Flächen zu nutzen: Parkplätze, Dächer oder Fassaden. Dort könnten Photovoltaikanlagen sinnvoll installiert werden. Was wir ablehnen, sind großflächige Solarparks, die mehrere Hektar Landwirtschaftsfläche beanspruchen und damit nicht nur Nutzfläche entziehen, sondern auch das Landschaftsbild massiv verändern. Uns ist bewusst, dass viele Eigentümer solche Anlagen aus finanziellen Gründen befürworten. Das sei ihnen auch zugestanden. Dennoch müssen wir als Kommune im Blick behalten, dass nicht jede Grünfläche mit PV-Anlagen verbaut wird. Denn genau diese grüne Natur macht das Leben in Kierspe lebenswert und liebenswert.
Der sinnvollste Schritt für Sie im Bereich erneuerbare Energien, sind also Solaranlagen auf bereits versiegelten Flächen?
Gerade auf versiegelten Flächen bietet sich die Nutzung von Photovoltaik an. Ein Beispiel ist die große Fläche am Fachmarktzentrum in Kierspe. Hätte man damals bei der Planung direkt daran gedacht, wäre das ein zukunftsweisender Schritt gewesen. Doch zu der Zeit war das Thema noch nicht so präsent, der Wille fehlte schlicht. Heute jedoch könnte man mit dem Eigentümer ins Gespräch gehen, um diese ohnehin versiegelten Flächen für PV-Anlagen zu nutzen. Auch das Forum an der Gesamtschule bietet Möglichkeiten. Dort ließen sich an verschiedenen Stellen Anlagen anbringen, die nicht nur erneuerbare Energie erzeugen, sondern zugleich auch Schatten spenden – etwas, das wir ohnehin immer wieder thematisieren.

In Ihrem Programm sprechen Sie von der klaren Ablehnung einer „Klimahysterie“ und kritisieren die deutschen Klimaziele. Können Sie das erläutern?
Es wird oft betont, welchen Anteil Deutschland am weltweiten Klimawandel hat. Legt man die Zahlen zugrunde, liegt unser Anteil am CO₂-Ausstoß bei rund zwei Prozent – ein verschwindet geringer Teil. Natürlich können wir Vorreiter sein. Aber wir müssen dabei mit Augenmaß handeln und dürfen nicht mit der Brechstange vorgehen. Vielmehr sollten wir Klimaschutz gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern, den Kommunen und dem Land Schritt für Schritt gestalten. Ja, wir brauchen erneuerbare Energien. Aber wir dürfen ihnen nicht alles unterordnen. Zunächst muss unser Land funktionsfähig bleiben – wir müssen die notwendigen Ausgaben finanzieren, ohne uns dauerhaft in immer neue Schulden zu stürzen. Erst wenn eine solide Basis vorhanden ist, können wir zusätzliche Maßnahmen umsetzen. Das bedeutet nicht, dass wir Projekte sofort und grundsätzlich ablehnen. Vielmehr geht es darum, neue Entwicklungen klug zu begleiten. Wenn neue Baugebiete erschlossen werden, sollte es selbstverständlich sein, Photovoltaikanlagen einzuplanen und über moderne Heizsysteme nachzudenken. Wichtig ist, den Weg zur Klimaneutralität sukzessive zu beschreiten, nicht mit einem starren Datum im Blick, das um jeden Preis erreicht werden muss. Denn genau das führt häufig zu überhasteten und aggressiven Eingriffen. Genau solche Eingriffe sind das, was wir ablehnen.
In Ihrem Wahlprogramm fordern Sie nicht noch mehr Flüchtlinge, stattdessen konsequentes Abschieben. Was bedeutet das für Kierspe? Würden Sie sich als Bürgermeister dafür einsetzen, weniger Geflüchtete zugewiesen zu bekommen oder worauf zielt diese Forderung ab?
Nach dem Brand im März waren wir bis Ende Juli von der Zuweisung ausgenommen. Ob diese inzwischen wieder greift, habe ich ehrlich gesagt noch nicht geprüft – der entsprechende Vertrag ist ja erst seit rund zwei Wochen ausgelaufen. Grundsätzlich ist uns aber wichtig, dass der Wohnraum, der derzeit für Asylbewerber und Migranten zurückgehalten wird, wieder der Bevölkerung zur Verfügung steht. Denn Kierspe sucht dringend Wohnraum. Ich habe das selbst erlebt: Vor drei Jahren habe ich eine Wohnung gesucht und keine einzige in ganz Kierspe gefunden, die unseren Vorstellungen entsprach. Am Ende waren wir gezwungen, nach Rönsahl auszuweichen, weil es hier schlicht keine passende Möglichkeit gab.
2024 hat Kierspe 800.000 Euro für Geflüchtete ausgegeben. Durch den Wohnraummangel malen Sie auch das Szenario einer Turnhallenbelegung oder einer Zeltstadt auf dem Sportplatz. Haben Sie das Gefühl Kierspe ist am Limit?
Was den Wohnraum betrifft, sind wir in Kierspe ganz klar am Limit. Der Brand im März hat das deutlich gezeigt. Genau deshalb wurde die Zuweisung seitens der Stadt ausgesetzt. Wäre ausreichend Wohnraum vorhanden gewesen, hätte man diesen Schritt nicht gehen müssen. Hätten wir genügend Reserven gehabt, hätten wir die Zuweisungen ganz normal weiterlaufen lassen können. Aber das war nicht der Fall – und genau darin zeigt sich, wie angespannt die Wohnraumsituation in Kierspe tatsächlich ist.
Was fordern Sie konkret von Bund und Land in dieser Hinsicht, um die Lage in der Kommune zu erleichtern?
Wichtig wäre aus unserer Sicht, dass mehr Rücksicht auf die Kommunen genommen wird. Wenn eine Stadt wie Kierspe klar sagt: Wir sind am Limit, wir können nicht mehr, dann sollte man Alternativen suchen, statt weiterhin Zwangszuweisungen vorzunehmen. Andernfalls wird die Bevölkerung zusätzlich belastet und es bleibt kein Wohnraum mehr für private Haushalte übrig. Die Konsequenz könnte sein, dass Menschen aus Kierspe abwandern, weil sie hier schlicht keine Wohnung finden. Um das zu verhindern, müssen wir dringend handeln: durch die Schließung von Baulücken und eine konsequente Nachverdichtung der bestehenden Wohngebiete. Wenn wir diese Möglichkeiten nicht nutzen, werden wir irgendwann gezwungen sein, doch wieder an zusätzliche Flächen heranzugehen – etwas, das wir aktuell eigentlich vermeiden wollen. Unser Ziel ist klar: Zuerst alles ausschöpfen, was im innerstädtischen Bereich möglich ist. Erst wenn dort keine Potenziale mehr bestehen, kann man über weitere Schritte nachdenken.
Ein weiteres Thema ist die Sicherheit. Sie beklagen zunehmenden Vandalismus und fordern schon seit 2014 ein Sicherheitskonzept. Was stellen Sie sich darunter vor? Was müsste passieren, dass Sie sich in Kierspe wieder sicher fühlen?
Wir brauchen mehr Präsenz auf den Straßen. Allein das Vorbeifahren des Ordnungsamts oder der Polizei reicht nicht aus. Auch der Sicherheitsdienst zeigt zu wenig Wirkung, weil er kaum das Gespräch mit den Menschen sucht. Vandalismus lässt sich nicht allein durch bloßes Beobachten eindämmen. Entscheidend wäre, dass man anhält, hinschaut und mit den Betroffenen redet. Deshalb fordern wir mehr sichtbare Präsenz: mehr Polizei, mehr Ordnungsamt. Früher hatten wir mit dem Sicherheitsdienst De Blois gute Erfahrungen gemacht. Dieser hat deutlich effektiver gearbeitet, bis es zu Unstimmigkeiten zwischen Verwaltung und Unternehmen kam und der Vertrag schließlich gekündigt wurde. Seitdem ist die Situation spürbar schlechter geworden: Ursprünglich standen dem Sicherheitsdienst 90 Stunden im Monat zur Verfügung heute sind es nur noch 50 Stunden. Allein an dieser Kürzung wird deutlich, warum wir im Stadtbild eine zu geringe Präsenz haben.
Sie fordern auch, sehr ambitioniert, eine eigene Polizeiwache für Kierspe.
Die Forderung nach einer eigenen Polizeiwache steht zwar immer noch in unserem Wahlprogramm, wurde jedoch seitens der Behörde in Lüdenscheid und auch vom Land NRW mehrfach abgelehnt. Der Grund liegt auf der Hand. Kierspe ist schlicht zu klein und verfügt nicht über die notwendige Personalstärke, um eine eigene Wache dauerhaft zu betreiben und zu unterhalten. Also ja, es steht in unserem Wahlprogramm, aber es lässt sich aus nachvollziehbaren Gründen nicht realisieren. Wichtig ist, das offen und transparent zu kommunizieren.
Zudem erwähnen Sie auch spezielle technische Einrichtungen zur Überwachung des öffentlichen Raums. Ist damit eine Videoüberwachung gemeint, oder was haben Sie sich vorgestellt?
Ein wirksames Mittel gegen Vandalismus und Unsicherheitsgefühle sind Kameras an Brennpunkten. Seit am Rathaus-Eingang eine Kamera installiert wurde, hat die Nutzung der Eingangstreppe deutlich nachgelassen. Auch der Vandalismus ist zwar nicht völlig verschwunden, aber spürbar zurückgegangen. Ähnlich verhält es sich mit der Kamera am Schwimmbad. Besucherinnen und Besucher fühlen sich dort sicherer, weil sie das Gefühl haben, nicht allein zu sein, zumindest bis sie in ihr Auto steigen. Gleichzeitig können die Aufzeichnungen im Bedarfsfall zur Aufklärung von Vorfällen beitragen. Weitere sensible Bereiche sind das Forum oder die Spielplätze am Felderhof. Dort ist immer wieder zu beobachten, dass etwa Tischtennisplatten in einem unzumutbaren Zustand hinterlassen werden. Erwachsene müssen den Müll aufsammeln, den Kinder und Jugendliche zurücklassen. Sport- und Freizeitangebote sollten gepflegt werden, damit sie ihren Zweck erfüllen. Hier ist nicht nur die Stadt gefragt, sondern auch jeder Einzelne, der Eigenverantwortung übernimmt: Niemand wirft zu Hause seinen Müll einfach hin, also sollte man es auch draußen nicht tun. Letztlich lässt sich dieses Bewusstsein nur durch direkte Ansprache fördern. Gespräche mit den Jugendlichen sind entscheidend, um klarzumachen, dass es so nicht geht. Dennoch halte ich es für gerechtfertigt, an bestimmten Brennpunkten mit Kameras zu arbeiten. Das bedeutet ausdrücklich nicht, dass ganz Kierspe überwacht werden soll, aber Stellen, an denen Vandalismus regelmäßig zum Problem wird, ist eine gezielte Videoüberwachung sinnvoll.
Die Voraussetzung für die Kamera bei der Schwimmhalle war eine Absperrung des Gebiets. Heißt das, sie wollen das Forum auch absperren?
Bei der Neugestaltung des oberen Schulhofs kam von der Schule selbst die Anregung, das Gelände einzuzäunen. Ziel war es, Vandalismus vorzubeugen und den Aufenthalt auf dem Schulhof nach Unterrichtsschluss einzuschränken. Ob ein kompletter Zaun für das gesamte Forum realistisch oder rechtlich möglich wäre, vermag ich nicht einzuschätzen. Aber an bestimmten Punkten sollte es durchaus machbar sein. Dort könnte ergänzend auch mit Kameras gearbeitet werden. Die Problemstellen sind dem Ordnungsamt und auch dem Sicherheitsdienst längst bekannt. Natürlich besteht das Risiko, dass sich die Jugendlichen einfach andere Plätze suchen, die nicht erfasst werden. Dann müsste man die Überwachung möglicherweise ausweiten. Trotzdem halte ich den Ansatz für sinnvoll. Ich persönlich habe damit keinerlei Probleme. Wer sich an Regeln hält und sich ordentlich verhält, muss auch nichts befürchten. Kompromittierende Aufnahmen entstehen so gar nicht erst.
Ihnen wird in Ihren Positionen oft eine gewisse Nähe zur AfD nachgesagt. Wie reagieren Sie auf diesen Vorwurf?
Ein ganz klares Nein. Wir sehen uns nicht in der Nähe der AfD. Wir sind weder radikal noch extremistisch. Im Gegenteil, wir wollen bürgernah und offen sein. Unser Anspruch ist es, Probleme anzusprechen, anstatt sie unter den Teppich zu kehren. Wir wollen auch, dass man Dinge sagen kann, ohne direkt Besuch von irgendeiner Behörde zu bekommen. Die AfD betrachten wir als Konkurrenten, welcher Gott sei Dank nicht in Kierspe antritt. Wir können uns glücklich schätzen, dass es hier noch keine starke AfD-Präsenz gibt, die das politische Klima nachhaltig verändern würde.
Glauben Sie, dass dies vielleicht daran liegt, dass Sie sehr ähnliche Positionen in
manchen Bereichen vertreten…
In manchen Bereichen, ja.
…und daher die Lücke schon füllen?
Ich glaube nicht, dass das komplette Wählerklientel der AfD automatisch zu uns wechseln würde. Aber dort, wo gesunder Menschenverstand gefragt ist und wo Bürger auch selbstkritisch sagen können: „Bis hierhin und nicht weiter“, da gibt es sicherlich Überschneidungen. In einzelnen Punkten mögen also ähnliche Positionen erkennbar sein. Trotzdem möchte ich die AfD nicht in Kierspe haben.
Ein weiteres Thema ist die Freiwillige Feuerwehr. Sie warnen vor Personalmangel und fordern ein Nachwuchs- und Motivationskonzept. Was genau haben Sie sich vorgestellt?
Wir sehen finanzielle Anreize als wichtiges Instrument, wie wir es auch in unserem Wahlprogramm festgehalten haben. Dazu gehört etwa, Pensionsansprüche oder Versicherungen bereitzustellen, damit Feuerwehrleute und ihre Familien im Ernstfall abgesichert sind. Hier muss auch weiterhin Geld in die Hand genommen werden. Das größere Problem ist jedoch der Nachwuchs. Wie in vielen Vereinen fällt es schwer, junge Menschen für den Dienst zu gewinnen. Besonders die Altersgruppe zwischen 15 und 30 Jahren fehlt uns häufig aufgrund von Schule, Studium, Ausbildung oder Wegzug. Die Jugendfeuerwehr läuft aktuell sehr gut und ist ein starkes Bindeglied zwischen Jugendlichen und der aktiven Wehr. Sie sollte noch stärker unterstützt werden. Langfristig müssen wir Kierspe so attraktiv gestalten, dass junge Menschen nach Ausbildung oder Studium zurückkehren und diejenigen, die in Kinder- und Jugendfeuerwehr begonnen haben, auch als Erwachsene dabeibleiben. Das wird eine große Herausforderung, zumal die Zahl der Jugendlichen insgesamt sinkt. Anders als in den 60er-Jahren, als die Babyboomer-Generation heranwuchs, haben wir heute nicht mehr diese Fülle an jungen Leuten, die für freiwillige Dienste angesprochen werden können.
Sie wollen außerdem mehr Bürgerbeteiligung. Sie fordern Bürgerversammlungen, Bürgerentscheide und eine Online-Plattform. Wie wollen Sie die Bürger zur tatsächlichen Beteiligung motivieren und verzögert eine dermaßen intensive Bürgerbeteiligung nicht die Entscheidungen?
Natürlich kann es sein, dass eine stärkere Mitsprache der Bevölkerung Entscheidungen zeitlich verzögert. Aber im Gegenzug wird ein breiteres Spektrum an Meinungen sichtbar und abgebildet. Ansonsten sind es nur die 34 Ratsmitglieder, die im Rat sitzen und entscheiden, auch wenn sie von den Bürgern gewählt werden. Doch im Laufe der Zeit verändern sich Einstellungen und Sichtweisen, sowohl in der Bevölkerung als auch bei denjenigen, die Ratsmitglieder gewählt haben. Eine öffentliche Diskussion bietet die Chance, die breite Masse einzubeziehen und Themen umfassender zu beleuchten. Darin liegt der entscheidende Vorteil: dass sich mehr Menschen aktiv mit dem Thema auseinandersetzen und nicht allein die zeitliche Begrenzung darüber entscheidet, wie Beschlüsse zustande kommen.
Wie wollen Sie verhindern, dass eventuell eine kleine Gruppe die Diskussion dominiert und sich da eventuell auch mal Meinungen verfälschen?
Da habe ich ad hoc keine Antwort parat, die ich Ihnen jetzt vorlegen könnte.
Gibt es noch etwas, das Sie gerne ansprechen würden?
Ein weiterer Punkt ist die Digitalisierung. Wünschenswert wäre, wenn Kommunen, Kreise, Länder und öffentliche Behörden stärker miteinander kommunizieren würden, und zwar so, dass Prozesse schneller umgesetzt werden können. Oft scheitert es am sprichwörtlichen „Amtsschimmel“: Es heißt, Personal fehle, Vorgänge müssten verschoben werden, Entscheidungen würden vertagt. Dabei könnte vieles einfacher sein, wenn alle mit derselben Software und den gleichen digitalen Systemen arbeiten würden. Dann ließen sich Abläufe besser verknüpfen und effizienter gestalten. Es wäre zu hoffen, dass wir diesen Schritt in naher Zukunft schaffen.
Könnte es nicht zur Gefahr des Gläsernen Bürgers führen, wenn alle Behörden dieselbe Software benutzen? Oder auch dazu, dass mit den Informationen nicht korrekt umgegangen wird?
Man braucht sich nur die sozialen Netzwerke anzuschauen: Dort geben viele Menschen bereitwillig sehr persönliche Informationen preis. Oft auch Dinge, bei denen andere sich fragen, warum überhaupt. Eigentlich war das nicht der ursprüngliche Sinn dieser Plattformen. Vor diesem Hintergrund halte ich es für wenig problematisch, wenn durch eine bessere digitale Zusammenarbeit von Behörden zusätzliche Daten gebündelt werden. Mehr preisgegeben als heute ohnehin schon freiwillig geschieht, wird dadurch nicht.
Ich persönlich kenne wenige Leute, die zum Beispiel ihre Steuerbescheide oder Strafverfolgungsakten online stellen. Wenn jetzt jeder Rathausmitarbeiter Zugriff auf diese Unterlagen hat, ist dies ja schon eine sehr andere Entwicklung als das, was in den sozialen Netzwerken gepostet wird.
Rathausmitarbeiter haben in bestimmten Fällen ohnehin die Möglichkeit, Informationen einzusehen. Etwa wenn es um die Berechnung von Leistungen oder finanziellen Ansprüchen geht. In solchen Situationen halte ich es für absolut legitim, wenn sie auf die notwendigen Daten zugreifen können. Inwieweit dieser Zugriff heute tatsächlich schon besteht, kann ich nicht beurteilen. Persönlich hätte ich damit aber kein Problem.
Auch wenn nicht, wenn in solchen Fällen polizeiliche Akten, Ermittlungsergebnisse und sonstige Sachen auftauchen?
Wer sich vorbildlich verhält, hat nichts zu verbergen. Ich selbst muss im Verein regelmäßig ein polizeiliches Führungszeugnis vorlegen. Für mich ist das selbstverständlich. Deshalb habe ich auch kein Problem damit, wenn solche Daten von den zuständigen Stellen eingesehen werden können. Wer Verantwortung trägt, muss sich auch entsprechend verhalten. Und wenn man weiß, dass im Führungszeugnis nichts Belastendes steht, warum sollte dann nicht auch die Möglichkeit bestehen, dies gemeinsam mit den zuständigen Behörden abzufragen? Für mich ist das völlig legitim und kein Problem.
Wir kommen zum Ende, Herr Howorka. Sie haben angekündigt, Kierspe zukunftsfestmachen zu wollen, damit die Stadt auch 2030, 2040 und 2050 lebens- und liebenswert ist. Nehmen wir an, Sie werden Bürgermeister. Wo soll Kierspe am Ende Ihrer Amtszeit stehen? Was wollen Sie erreicht haben, damit Sie sagen können: „Ja, wir sind auf dem richtigen Weg“.
In den kommenden fünf Jahren möchte ich vor allem zukunftsgerichtete Themen anstoßen. Insbesondere in den Bereichen Verkehr, Verwaltung und Politik, sowie Bürgerbeteiligung. Natürlich werden wir nicht alle mitnehmen können und auch nicht jeden Wunsch erfüllen. Aber es geht darum, einen Ansatz zu schaffen, auf dem wir aufbauen können. Mein Ziel ist, dass wir in fünf Jahren an dem Punkt stehen, von dem aus wir weiterentwickeln können, dass wir die Grundlagen gelegt haben, um die nächsten dringend notwendigen Schritte anzugehen.
Welche Schlagzeile würden Sie sich am Ende Ihrer ersten Amtszeit wünschen?
Danke. Bitte eine zweite Amtszeit.
Und welche auf keinen Fall?
Er war stets bemüht.
Hinweis der Redaktion: Eine Vorstellung mittels Video wie in den anderen Bürgermeisterinterviews von LokalDirekt, lehnte Nico Howorka ab.